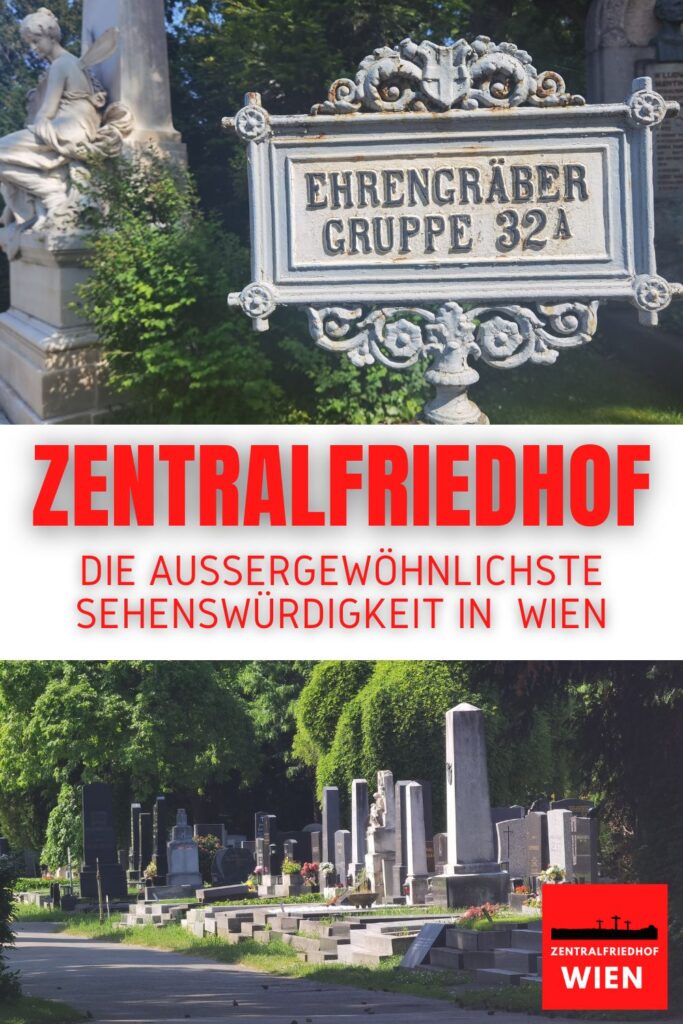Der Zentralfriedhof in Wien ist nicht nur der größte Friedhof der Stadt, sondern auch einer der größten Friedhöfe Europas. Er wurde 1874 eröffnet und beherbergt etwa 330.000 Gräber, darunter die Ruhestätten zahlreicher berühmter Persönlichkeiten wie Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms und Franz Schubert. Mit seinen prachtvollen Grabanlagen, weitläufigen Wegen und beeindruckenden Denkmälern ist der Zentralfriedhof ein Ort der Erinnerung und gleichzeitig ein wunderschöner Park, der zum Verweilen und Nachdenken einlädt. Bevor ich dir meine persönlichen Erlebnisse und Tipps gebe, hier noch ein paar Informationen vorab:
–> das sind die Zentralfriedhof Öffnungszeiten
–> das Tor 2 ist perfekt für deine Anreise
–> so geht die Zentralfriedhof Anfahrt
Geheimtipp Wien: Ein weiterer bemerkenswerter Friedhof in Wien ist der Sankt Marx Friedhof. Dieser historische Friedhof wurde 1874 geschlossen und ist heute ein wunderschöner Park, der als Denkmal für das Wiener Biedermeier gilt. Hier liegt auch Wolfgang Amadeus Mozart begraben, dessen Grabstätte von Musikliebhabern aus aller Welt besucht wird. Der Sankt Marx Friedhof ist ideal für einen entspannten Spaziergang abseits der touristischen Pfade. –> Sankt Marx Friedhof
Lies dir all diese Beiträge auf der Webseite aufmerksam durch, damit du nichts verpasst. Tausende andere Besucher waren bereits für diese Tipps dankbar. Du kannst sie auch gerne mit deinen Freunden teilen. Ein Klick am Ende dieses Beitrags genügt, um den Beitrag kostenlos über WhatsApp, E-Mail oder Facebook zu teilen
Nun wünsche ich dir eine eindrucksvolle Zeit auf dem Wiener Zentralfriedhof!
DER REISEBLOGGER
Markus Schmidt

Zentralfriedhof Wien – letzte Ruhestätte & Sehenswürdigkeit
Der Wiener Zentralfriedhof ist eine der bedeutendsten Friedhofsanlagen Europas. Er wurde im Jahr 1874 eröffnet, weil es in der Innenstadt keinen Platz mehr gab. Bei seiner Eröffnung lag der Zentralfriedhof nicht so zentral, sondern am Stadtrand in Simmering. Heute ist Simmering einer der Wiener Stadtbezirke. Der Friedhof ist immer noch in Betrieb und es finden laufend weitere Bestattungen statt. Er ist nicht nur Friedhof, sondern aufgrund seiner Besonderheiten eine Sehenswürdigkeit für Touristen und Einheimische. Der Zentralfriedhof in Wien ist berühmt wegen seiner zahlreichen Ehrengräber, der Jugendstil-Bauwerke, der religionsübergreifenden Gräber und seines weitläufigen Geländes, das an einen Park erinnert. Er eine besondere Attraktion und ein beeindruckendes Wahrzeichen der Stadt.
Einer der größten Friedhöfe in Europa
Der Zentralfriedhof Wien zählt zu den größten Friedhöfen in Europa. Auf einer Fläche von fast zweieinhalb Quadratkilometern erstreckt sich die riesige Anlage, die sogar mit Straßen erschlossen ist – ja richtig gelesen: Durch den Wiener Zentralfriedhof verlaufen geteerte Straßen. Auf dem Friedhof befinden sich rund 330.000 Grabstellen, auf denen etwa drei Millionen Verstorbene ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Damit „wohnen“ in der toten Stadt mehr Menschen, als heute in Wien wohnen. 3 Millionen Verstorbene liegen auf dem Friedhof, rund 2 Millionen Einwohner zählt die Stadt Wien. Im Laufe seiner Geschichte wurde der Zentralfriedhof siebenmal erweitert, zuletzt im Jahr 1921. Bei seiner Eröffnung galt er als der größte Friedhof Europas. Nimmt man die Anzahl der bestatteten Verstorbenen, hält er diesen Titel bis heute. Flächenmäßig wird jedoch mittlerweile vom Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg (mit einer Fläche von vier Quadratkilometern) und vom Brookwood Cemetery nahe London übertroffen. Der berühmte Friedhof in Wien erstreckt sich auf einer Fläche, die in etwa der Größe der Wiener Innenstadt entspricht.
Wer verwaltet den Wiener Zentralfriedhof?
Seit 2008 fällt die Verwaltung des Zentralfriedhofs in den Zuständigkeitsbereich der Friedhöfe Wien GmbH (früher Magistratsabteilung 43, „Städtische Friedhöfe“), zu der auch die untergeordneten Einrichtungen „Städtische Friedhofsgärtnerei“ und „Städtische Steinmetzwerkstätte“ gehören. Letztere müssen sich jedoch gegenüber einer Vielzahl konkurrierender Friedhofsgärtnereien und Steinmetzbetriebe behaupten, die entlang der Simmeringer Hauptstraße in der Nähe angesiedelt sind.
Ein Friedhof für alle




Normalerweise ist ein Friedhof einer Kirchengemeinde und damit einer Konfession zugeordnet. Nicht so der Wiener Zentralfriedhof. Er ist interkonfessionell und bietet jedem Verstorbenen eine Ruhestätte, unabhängig von der Glaubensrichtung. Wie schon Wolfgang Ambros in der berühmten Hymne über den Zentralfriedhof singt: Hier liegen Juden neben Arabern. Der Zentralfriedhof in Wien besteht aus dem interkonfessionellen Hauptfriedhof, auf dem Verstorbene unabhängig von ihrer Glaubensrichtung ihre letzte Ruhestätte finden können. Rund um diesen Bereich sind verschiedene konfessionelle Friedhöfe und besondere Abteilungen angelegt. Der überwiegende Teil des Hauptfriedhofs besteht seit jeher aus katholischen Gräbern. Darüber hinaus gibt es heute separate Bereiche für Buddhisten, Evangelische, Muslime (alte, neue und islamisch-ägyptische Abteilung), Juden (alter und neuer Friedhof), Orthodoxe (russisch, griechisch, rumänisch usw.) und Mormomen.
Wenn du den Friedhof betrittst sieht du auf der Übersichtstafel die unterschiedlichen Bereiche. Es gibt auch einen eigenen Bereich für die österreichischen Staatsmänner. In der Präsidentengruft finden die österreichischen Bundespräsidenten seit 1870 ihre letzte Ruhestätte. Ehrengräber und ehrenhalber gewidmete Gräber auf dem Wiener Zentralfriedhof sind eine bedeutende Attraktion des Friedhofs und dienen als letzte Ruhestätten berühmter Persönlichkeiten. Ursprünglich wurde 1885 mit der Einrichtung der ersten Ehrengräbergruppe begonnen, um den Friedhof für Besucher attraktiver zu gestalten. Seit 1954 gibt es neben den Ehrengräbern auch die Kategorie der ehrenhalber gewidmeten Gräber, die sich entweder in der Ehrengräbergruppe 40 (Ehrenhain) oder vereinzelt in anderen Bereichen des Friedhofsgeländes befinden. Insgesamt gibt es mehr als 350 Ehrengräber und über 600 ehrenhalber gewidmete Gräber auf dem Zentralfriedhof. Einige der bekanntesten Persönlichkeiten, die hier bestattet wurden, sind Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Ludwig Boltzmann, Carl Ritter von Ghega, Adolf Loos und Siegfried Marcus. Das Grabmal von Wolfgang Amadeus Mozart ist zwar ein beliebtes Ziel für Touristen, enthält jedoch keine sterblichen Überreste, da Mozarts Grab auf dem Sankt Marxer Friedhof liegt. Besonders besucht wird der Ehrenhain in der Gruppe 40, wo sich ehrenhalber gewidmete Gräber von Persönlichkeiten befinden, die größtenteils nach den 1960er Jahren verstorben sind. Das Grab von Falco, dem 1998 verstorbenen Popstar, ist eines der am häufigsten besuchten Gräber in dieser Gruppe und hat sich zu einer regelrechten Pilgerstätte für Falco-Fans entwickelt.
Die Liste der Ehrengräber umfasst eine Vielzahl von prominenten Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen. Unter ihnen sind Schriftsteller wie Ludwig Anzengruber, Karl Kraus und Franz Werfel, Komponisten wie Franz Schubert, Johann Strauss (Vater und Sohn) und Arnold Schönberg, Schauspieler wie Hans Moser, Curd Jürgens und Paul Hörbiger, Architekten wie Theophil von Hansen und Ernst Hoffmann, sowie Politiker wie Bruno Kreisky und Julius Raab. Diese Gräber sind nicht nur Orte des Gedenkens, sondern auch wichtige kulturelle und historische Zeugnisse. Zusätzlich zu den Ehrengräbern gibt es ehrenhalber gewidmete Gräber, die ebenfalls bedeutenden Persönlichkeiten gewidmet sind. Hier finden sich Namen wie Falco, Udo Jürgens, Christiane Hörbiger, Karl Lueger, Karl Kraus, Matthias Sindelar und Friedrich Torberg. Diese Gräber tragen zur Vielfalt und Bedeutung des Zentralfriedhofs als Ort des Gedenkens und der Erinnerung bei.
–> die Liste der Ehrengräber
–> hier ist das Falco Grab
–> hier ist das Udo Jürgens Grab
–> hier ist das Mozart Grab
Friedhofskirche zum heiligen Karl Borromäus

Die Friedhofskirche zum heiligen Karl Borromäus wurde von Hegele entworfen und zwischen 1908 und 1910 erbaut. Die imposante Kirche stellt das kreative und geografische Zentrum des Geländes dar. Dieses Jugendstil-Bauwerk beherbergt Glasfenster und Wandmosaike von Leopold Forstner und enthält unter anderem die Gruft des verstorbenen Wiener Bürgermeisters Karl Lueger, der den Grundstein für die Kirche legte. Aufgrund dessen ist die Kirche auch als Dr.-Karl-Lueger-Gedächtniskirche bekannt. Die Kirche ist sehenswert, hier einige Bilder und weitere Informationen:
–> Friedhofskirche zum heiligen Karl Borromäus
Friedhof mit Park und Tieren

Ja, der Zentralfriedhof in Wien ist nicht nur ein Friedhof, sondern aufgrund seiner enormen Größe und der Vielfalt an Pflanzen und Tieren auch ein Park und ein Naturraum. Aufgrund der ausgedehnten Grünflächen, der Alleen und des dichten Baumbestandes bietet der Friedhof Lebensraum für verschiedene Tierarten. Am Zentralfriedhof lebt eine Vielzahl an Tieren wie Eichhörnchen, Rehe, Turmfalken, Marder und Dachse. Als wir den Friedhof besucht haben und auf einer Bank Pause gemacht haben, konnten wir Rehe beobachten. Die Stadt Wien hat Maßnahmen ergriffen, um die ökologische Vielfalt des Friedhofs zu erhalten und zu schützen, indem sie naturnahe Bereiche bewahrt. Früher wurde auf dem Zentralfriedhof sogar gejagt, um den Tierbestand nicht zu stark anwachsen zu lassen.
Wie kommt man am besten zum Zentralfriedhof Wien?
Der Zentralfriedhof Wien befindet sich in Simmering. Er ist von der Innenstadt bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Die Zufahrt ist auch mit dem PKW möglich. Kostenpflichtige Parkplätze sind vorhanden. Für Besucher sind das Tor 2 und Tor 3 die beliebtesten Eingänge. Am Tor 2 befindet sich der offizielle Infopoint, wo Besucher einen Zentralfriedhof Wien Plan erhalten können. Tor 3 ist ebenfalls eine häufig genutzte Eingangsmöglichkeit und führt zum Park der Ruhe und Kraft. Du findest alle Details für deine Anreise hier:
–> Anfahrt und Anreise
–> Zentralfriedhof Wien Plan
Bestattungskalener & Verstorbenensuche
Der Bestattungskalender und die Verstorbenensuche sind wichtige Services, die angeboten werden, um den Menschen dabei zu helfen, Informationen über bevorstehende Bestattungen oder bereits beigesetzte Verstorbene zu finden. Der Bestattungskalender bietet eine Übersicht über die Termine von bevorstehenden Bestattungen auf den Friedhöfen. Er enthält Informationen wie Datum, Uhrzeit und den Namen des Verstorbenen. Dieser Service erleichtert es den Menschen, sich über die Termine von Beerdigungen zu informieren, wenn sie beispielsweise an einer Trauerfeier teilnehmen möchten. Die Verstorbenensuche ermöglicht es Nutzern, Informationen über bereits beigesetzte Personen zu finden. Hierbei kann man nach dem Namen des Verstorbenen suchen und erhält Details wie das Grab, die Gruppe oder den Bereich des Friedhofs, in dem die Person beigesetzt wurde. Dieser Service ist nützlich, wenn man das Grab einer bestimmten Person auf einem Friedhof suchen möchte oder um herauszufinden, ob jemand auf einem Friedhof beigesetzt wurde.
–> Bestattungskalender Wien
–> Verstorbenensuche
Welche Gräber gibt es auf dem Zentralfriedhof?
Auf dem Wiener Zentralfriedhof gibt es verschiedene Arten von Gräbern und Grabstätten, die unterschiedliche Bestattungsoptionen bieten. Hier sind einige der Gräber, die auf dem Zentralfriedhof verfügbar sind:
Klassische Familiengräber für Sarg und Urne: Diese Gräber bieten Platz für eine bestimmte Anzahl von Verstorbenen und sind für Särge oder Urnen geeignet. Sie variieren in der Größe je nach Anzahl der Bestattungen.
Klassische Urnengräber: Speziell für die Beisetzung von Urnen vorgesehen, bieten diese Gräber Platz für eine festgelegte Anzahl von Urnen.
Grüfte (Mausoleen): Dies sind oft größere, oberirdische Grabstätten, die mehrere Verstorbene aufnehmen können. Sie sind oft architektonisch gestaltet und können als Familiengräber dienen.
Urnengrüfte: Ähnlich wie Grüfte, aber für Urnenbestattungen. Sie bieten Platz für mehrere Urnen und können unterschiedliche architektonische Ausführungen haben.
Urnenwandnischen: Dies sind in der Regel kleinere Nischen in einer Mauer, in denen Urnen platziert werden können. Sie bieten Platz für eine begrenzte Anzahl von Urnen.
Sargwandnischen: Ähnlich wie Urnenwandnischen, aber für Särge. Diese Nischen sind für die Beisetzung einzelner Verstorbener konzipiert.
Naturgräber: Diese Art von Grabstätten, wie Baum-, Strauch- oder Rasengräber, sind oft in naturnahen Bereichen angelegt. Sie bieten eine natürlichere Umgebung für die Bestattung von Verstorbenen.
Waldgräber: Ähnlich wie Naturgräber, sind Waldgräber in Waldgebieten angelegt und bieten eine naturnahe Bestattungsumgebung.
Familien- und Freundschaftsbäume: Spezielle Bäume, an denen kleine Gedenktafeln für Verstorbene angebracht werden können. Diese Option bietet eine einzigartige Erinnerungsstätte.
Urnengarten, Regenwasserurne, Wiener Naturgrab: Spezielle Bereiche oder Grabarten für die Beisetzung von Urnen in bestimmten Umgebungen oder in besonderen natürlichen Umgebungen.
Es lebe der Zentralfriedhof
Die Wiener haben einen besonderen Bezug zum Tod – und zu ihrem Zentralfriedhof. Als der berühmte Friedhof 100 Jahre alt wurde, stolperte der Wiener Liedermacher Wolfgang Ambros über das Plakat der Feierlichkeiten. Daraufhin entstand eines seiner berühmtesten Lieder „Es Lebe der Zentralfriedhof“.
–> Es lebe der Zentralfriedhof
Besuch auch den St. Marx Friedhof
Der St. Marx Friedhof in Wien ist ein geschichtsträchtiger Begräbnisort, der seine Wurzeln im Jahr 1784 hat und bis 1874 als Ruhestätte diente. Er repräsentiert den letzten verbliebenen Biedermeier Friedhof in Wien und spiegelt die kulturelle Atmosphäre dieser bedeutenden Epoche wider. Die Friedhofsanlage ist nicht nur historisch relevant, sondern zeichnet sich auch durch ihre Biedermeierarchitektur aus, die durch schlichte Eleganz und sentimentale Ästhetik gekennzeichnet ist. Bekannt ist der St. Marx Friedhof insbesondere durch die Gräber zahlreicher prominenter Persönlichkeiten aus den Bereichen Kunst, Musik, Wissenschaft und Politik. Die Grabstätte von Wolfgang Amadeus Mozart ist von besonderer Bedeutung und befand sich ursprünglich hier, bevor der Komponist später auf den Zentralfriedhof umgebettet wurde.
Die Biedermeierzeit prägt nicht nur die Architektur der Grabmäler, sondern auch die kulturelle Identität Wiens. Die architektonische Vielfalt der Gräber reicht von schlichten Grabsteinen bis zu aufwendigen Mausoleen, was die Vielfalt der Bestattungskultur dieser Zeit widerspiegelt. Heutzutage ist der St. Marx Friedhof eine touristische Attraktion. Menschen besuchen ihn, um die Gräber berühmter Persönlichkeiten zu sehen und die einzigartige Atmosphäre des Friedhofs zu erleben. Insgesamt präsentiert der St. Marx Friedhof eine faszinierende Perspektive auf die Biedermeierzeit und einer der Wien Geheimtipps.
–> St. Marxer Friedhof
Häufige Fragen zum Zentralfriedhof Wien
Eine der letzten gestalterischen Neuerungen auf dem Zentralfriedhof ist der „Park der Ruhe und Kraft“, der von Architekt Christof Riccabona entworfen und von der Städtischen Steinmetzwerkstätte unter der Leitung von Leopold Grausam jun. im Jahr 1999 eröffnet wurde. Es handelt sich um einen geomantischen Landschaftspark, der in fünf unterschiedlich gestaltete Bereiche unterteilt ist und Besucher zur körperlichen und geistigen Entspannung sowie zur Besinnung einlädt.
Ja, im Falle des Zentralfriedhofs ist das erlaubt – außer an Allerheiligen. Am 01.11. ist das Besucheraufkommen zu groß. Deshalb müssen an diesem Tag die Autos draußen bleiben. An allen anderen Tagen kannst du zum Beispiel beim Tor 2 oder Tor 3 durch die Schrankenanlage mit dem Auto in den Friedhof hineinfahren. Man will damit auch allen Besuchern den Zugang auf dem weitläufigen Friedhof ermöglichen. Motorräder sind übrigens verboten.
Ja, auch die Einfahrt und Durchfahrt mit dem Fahrrad ist erlaubt.
In den meisten Fällen werden Bestattungen auf dem Zentralfriedhof von der „Bestattung Wien“ durchgeführt, einem Unternehmen, das sich im Besitz der Stadt Wien befindet und zur Wiener Stadtwerke Holding AG gehört. Bis vor einigen Jahren hatte die Bestattung Wien ein Monopol. Dieses ist seit dem Jahr 2002 gefallen. Seitdem bieten auch verschiedene andere Bestatter auf dem Wiener Zentralfriedhof ihre Dienste an. Bei der Gestaltung der Verabschiedung haben die Hinterbliebenen viele Freiheiten, angefangen bei der (manchmal unkonventionellen) Auswahl der Musik während der Trauerfeier bis hin zur Möglichkeit, den Sarg auf einer historischen, sechsspännigen Trauerkutsche von der Aufbahrungshalle zum Grab zu begleiten.
Der Wiener Zentralfriedhof ist ein besonderer Ort in Europa. Hier sind einige weitere außergewöhnliche Sehenswürdigkeiten in Europa mit kurzen Beschreibungen und ihren Websites:
– Schiefer Turm von Pisa, Italien (https://www.schiefer-turm-von-pisa.com): Der Schiefe Turm von Pisa ist eine der bekanntesten und ungewöhnlichsten Sehenswürdigkeiten Europas. Seine charakteristische Schieflage entstand aufgrund eines Fundamentfehlers während des Baus im 12. Jahrhundert. Trotz dieser ungewollten Neigung ist der Turm ein faszinierendes architektonisches Meisterwerk und ein Symbol für Pisa.
– Prebischtor, Tschechien (https://www.prebischtor.com/): Das Prebischtor ist das größte Felsentor in Europa und befindet sich in der Böhmischen Schweiz nahe der deutsch-tschechischen Grenze. Es ist ein imposantes Naturdenkmal, das aus Sandstein geformt wurde und sich majestätisch über dem umliegenden Wald erhebt.
– Pragser Wildsee, Italien (https://www.pragser-wildsee.it/): Der Pragser Wildsee, auch als Lago di Braies bekannt, ist ein zauberhaft schöner Bergsee in den Dolomiten. Sein türkisfarbenes Wasser vor der Kulisse der umliegenden Berge macht ihn zu einem der malerischsten Seen Europas.
– Felsenlabyrinth Luisenburg, Deutschland (https://www.felsenlabyrinth-luisenburg.de/): Das Felsenlabyrinth Luisenburg ist das größte Felsenlabyrinth Europas und befindet sich in der Nähe von Wunsiedel in Deutschland. Dieses natürliche Labyrinth aus Felsen und Wegen bietet ein einzigartiges und abenteuerliches Erlebnis für Besucher jeden Alters.
– Walhalla, Deutschland (https://www.walhalla.info): Die Walhalla ist ein prächtiges klassizistisches Denkmal bei Regensburg in Deutschland. Es wurde 1842 erbaut und beherbergt eine Ruhmeshalle, in der bedeutende Persönlichkeiten der deutschen Geschichte mit Büsten und Gedenktafeln geehrt werden. Die Walhalla bietet einen eindrucksvollen Blick auf die Donau und ist ein Symbol für deutsche Kultur und Geschichte.
– Ponte Vecchio, Florenz, Italien (https://www.ponte-vecchio-firenze.com): Die Ponte Vecchio ist eine der bekanntesten Brücken der Welt und befindet sich in Florenz über dem Fluss Arno. Sie ist für ihre historischen Juwelierläden bekannt, die sich entlang der Brücke erstrecken und ihr ein einzigartiges und charmantes Ambiente verleihen.
– Marienbrücke (Marienbrücke Neuschwanstein), Deutschland (https://www.marienbruecke-neuschwanstein.de): Die Marienbrücke bietet eine der besten Aussichten auf das berühmte Schloss Neuschwanstein in Bayern, Deutschland. Diese Brücke überspannt eine Schlucht und bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf das majestätische Schloss Neuschwanstein und die umliegende Landschaft.
– Karlsbrücke, Prag, Tschechische Republik (https://www.karlsbruecke.de): Die Karlsbrücke ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Prag. Diese historische Brücke über die Moldau verbindet die Altstadt mit der Kleinseite und ist gesäumt von beeindruckenden barocken Statuen. Die Brücke bietet einen malerischen Blick auf die Prager Burg und die Altstadt und ist ein beliebter Ort für Spaziergänge und Fotomotive.
– Las Ramblas, Barcelona, Spanien (https://www.ramblas-barcelona.de): Las Ramblas ist eine der berühmtesten Straßen in Barcelona, die vom Plaça de Catalunya bis zum Hafen führt. Diese lebhafte Promenade ist bekannt für ihre Straßencafés, Märkte, Künstler und Geschäfte. Sie ist ein zentraler Anlaufpunkt für Touristen, die das pulsierende Herz der Stadt erleben möchten.
Diese Orte sind wunderbare Beispiele für die Vielfalt und Schönheit der Sehenswürdigkeiten, die Europa zu bieten hat.
Ja, wir finden schon. Der Zentralfriedhof Wien ist nicht nur eine letzte Ruhestätte, sondern auch ein beeindruckendes kulturelles und historisches Erbe. Hier sind viele bedeutende Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und Wissenschaft begraben, darunter Johann Strauß, Ludwig van Beethoven und Falco. Kunstvolle Grabstätten, majestätische Mausoleen und üppige Grünflächen prägen das Bild des Zentralfriedhofs. Ein Spaziergang durch seine weitläufigen Alleen bietet nicht nur eine ruhige Flucht aus dem Trubel der Stadt, sondern auch die Möglichkeit, die vergangenen Epochen durch die Architektur und die Geschichten der Verstorbenen zu erleben.
Ein Hinweis in eigener Sache
Liebe Bloggerkollegen, Journalisten und alle anderen, die diese Informationen lesen, um sie in irgendeiner Form weiter zu verwenden. Diese komplette Webseite ist urheberrechtlich geschützt. Wir haben in aufwendigen Vor-Ort-Recherchen alle diese Informationen und Fakten über den Wiener Zentralfriedhof zusammengetragen. Bevor wir sie hier veröffentlicht haben, waren sie anderweitig nirgends im Internet zu finden. Daher können wir als Quelle sehr schnell etwaige Plagiate und „Abschreiber“ identifizieren. Ein Kopieren des Textes ist sowieso widerrechtlich. Wenn du jedoch einzelne Daten dieser Webseite verwendest, gebietet es die journalistische Ehre, diese Webseite zu verlinken.
Zentralfriedhof Wien merken
Wenn dir die Eindrücke vom Zentralfriedhof in Wien gefallen haben, empfehle ich dir, diese Webseite gleich zu merken. So findest du sie bei der Planung deines nächsten Ausflugs oder Urlaubs wieder. Zu oft ist es uns schon passiert, dass wir uns gute Ideen und Tipps nicht gleich gemerkt haben. So mußten wir später lange danach suchen. Spar dir das, merk dir den Beitrag mit einem Pin auf Pinterest, schick dir den Link als WhatsApp oder Email. Klick dazu einfach auf den entsprechenden Button unter den Bildern. Einfach und kostenlos.